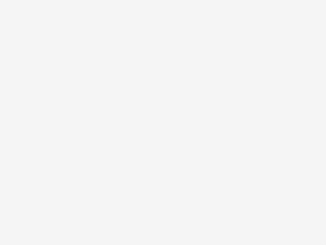Bewerbungspiraten sind ein Schreckgespenst für Arbeitgeber. Sie bewerben sich nicht auf Stellenanzeigen, weil sie einen Job suchen, sondern damit sie abgelehnt werden. Anschließend verklagen sie das Unternehmen wegen Diskriminierung und fordern Entschädigung. Zwei neue Urteile zeigen, dass Arbeitsgerichte für Nassauer nichts übrig haben.
Hintergrund: Viele Arbeitgeber haben vor der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) befürchtet, dass sich das neue Gesetz als Einladung für Stellenpiraten entpuppt. Bekanntlich wird nichts so heiß gegessen wie gekocht. Das trifft auch auf das Gesetz zu, das die Unternehmen beim Thema Gleichbehandlung stärker in die Pflicht nimmt. Richtig ist, dass das AGG die Diskriminierung explizit für acht Merkmale verbietet. Zu diesen gehören die Merkmale Rasse, Geschlecht, Alter, Behinderung, ethnische Herkunft, Religion, Weltanschauung und sexuelle Identität. Verstößt ein Unternehmen gegen das Verbot, muss es Schadenersatz leisten.
Das Arbeitsgericht Berlin urteilte, dass es noch lange keine Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft ist, nur weil sich ein Arbeitgeber gegen den Bewerber ohne Deutschkenntnisse entscheidet (Aktenzeichen: 14 Ca 10356/07).
Im Urteilsfall hatte sich ein Engländer über eine angebliche Diskriminierung beschwert. Der Vorgang: Der Mann bewarb sich als Gärtner, ein Probetag wurde angesetzt und abgebrochen. Angeblich wegen Sprachproblemen, behauptete der Brite vor Gericht. Stimmt nicht, verteidigte sich der Arbeitgeber, der Mann sei für den Job schlicht ungeeignet. Nicht einmal die Motorsäge habe er richtig bedienen können. Man habe sie ihm sofort wieder abgenommen.
Ob nun ein Kettensägenmassaker drohte oder nicht, das Gericht entschied gegen eine Entschädigung. Für Arbeitgeber ist damit klar: Sie dürfen vom Kandidaten getrost gute Kenntnisse der deutschen Sprache verlangen. Eine Diskriminierung wegen ethnischer Herkunft ist das nicht. Nicht einmal indirekt, urteilte das Gericht, auch wenn Deutsche der deutschen Sprache eher mächtig sind als Menschen anderer Herkunft.
Kein Anspruch auf Einsicht in Bewerbungsmappen
Der zweite Fall hat sich vor dem Landesarbeitsgericht Hamburg abgespielt (Aktenzeichen: H 3 Sa 102/07). Dort hatte eine Frau über eine vermeintliche Diskriminierung geklagt. Zweimal habe sie sich auf eine Stellenausschreibung beworben. Zweimal sei sie abgelehnt worden. Nicht einmal zum Vorstellungsgespräch sei sie eingeladen worden. Und das bei ihrer Qualifizierung. Die Diskriminierung hielt sie für offenkundig, schließlich sei sie weiblich, 45 Jahre alt und nicht deutscher Herkunft. Der Arbeitgeber solle ihr das Gegenteil beweisen.
So einfach ist die Sache nun doch nicht, urteilten die Richter. Wer den Vorwurf der Diskriminierung erhebt, muss diesen Vorwurf zumindest so gut mit Indizien belegen, dass sich eine Benachteiligung aus einem der gesetzlich genannten acht Gründe vermuten lasse. Mit konkreten Belegen konnte die Frau im Verfahren aber nicht aufwarten.
Das Gericht prüfte die beiden Stellenanzeigen und die schriftliche Absage an die Bewerberin. Nirgends fand sich auch nur ein Anhaltspunkt für eine Diskriminierung. Selbst die Behauptung der Frau, sie sei die beste Kandidaten gewesen, zog vor Gericht nicht. Die Richter sahen darin lediglich eine persönliche Einschätzung, nicht aber den Beleg dafür, dass sich für den Arbeitsplatz keine anderen gleich guten oder sogar besseren Kandidaten beworben hätten. Und wo es keine Anhaltspunkte für eine Diskriminierung gibt, dreht sich die Beweislast auch nicht zum Nachteil des Unternehmens um.
Genau auf diesen Mechanismus könnte die Klägerin spekuliert haben: Das Unternehmen sollte kraft Vermutungsregel in die Defensive geraten. Denn wenn ein Arbeitsgericht eine Benachteiligung des Arbeitnehmers aufgrund von Indizien vermutet, muss plötzlich der Arbeitgeber beweisen, dass er die Grundsätze der Gleichbehandlung dem ersten Anschein zum Trotz doch nicht verletzt hat.
Im Urteilsfall hatte die Klägerin vom Unternehmen sogar Einsicht in die Bewerbungsunterlagen des erfolgreichen Kandidaten verlangt. Auch daraus wurde nichts. Das Landesarbeitsgericht Hamburg entschied, dass es so einen weitgehenden Auskunftsanspruch bei Klagen wegen Diskriminierung bei der Stellenbesetzung nicht gibt.