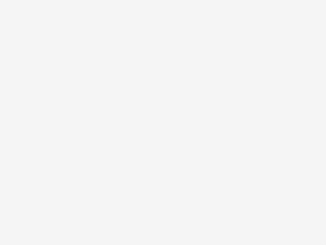Die Informationspolitik der Commerzbank verwirrt die Anleger der VIP-Medienfonds. Auf dem Spiel stehen Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe, die Bankkunden endgültig verlieren, wenn sie auf die Verjährungsfrage eine falsche Antwort erhalten.
Die Kanzlei Kälberer & Tittel Rechtsanwälte aus Berlin stellt klar: Anleger können die Commerzbank und andere Anlageberater wegen fehlerhafter Anlageberatung bei den VIP-Medienfonds mindestens bis 31.12.2008 auf Schadensersatz verklagen. Das zeigt ein Urteil des Landgerichts (LG) Berlin gegen einen Anlageberater (14 O 55/08), das die Kanzlei Kälberer & Tittel erstritten hat.
Die Kanzlei warnt Anleger der VIP-Medienfonds vor einem Verlust ihrer Rechte gegenüber der Commerzbank und sonstigen Vermittlern der VIP-Fonds. Im Kern geht es um die Frage, wann die Schadensersatzansprüche der VIP-Anleger gegen ihre Anlageberater verjähren. „Die Commerzbank hat den Anlegern der VIP-Medienfonds jahrelang mit einem Verzicht auf die angeblich bestehende Verjährungseinrede Sand in die Augen gestreut. Jetzt baut sie offenbar darauf, dass die Anleger die Flinte ins Korn werfen“, erklärt Rechtsanwalt Dietmar Kälberer. Auf dem Spiel stehen etwa 635 Millionen Euro. Diese Summe haben Anleger mit den VIP-Medienfonds verloren.
Kälberer gibt auf die Verjährungsfrage eine klare Antwort: „Die VIP-Anleger können ihre Beraterbank mindestens noch bis zum 31.12.2008 verklagen.“
Womit Anleger bei der Commerzbank rechnen sollten
Hintergrund: Die Commerzbank hat jahrelang erklärt, sie wolle bei den VIP-Medienfonds auf den Einwand der Verjährung verzichten. Doch dann änderte die Bank plötzlich ihre Meinung. Erst auf Nachfrage erfuhren die Anlegeranwälte zwei Wochen vor Ablauf der bisherigen Verzichterklärung von der Commerzbank, dass diese ihre Verzichterklärung nicht verlängern würde. „Die Bank setzt wahrscheinlich auf ein fragwürdiges Urteil aus Frankfurt und baut bei der Verjährung auf eine für sie vorteilhafte Zeitrechnung“, vermutet Kälberer.
Beratungsfehler verjähren drei Jahre nach Kenntnis, wobei der Fristablauf zum Jahresende beginnt, in dem der Kunde von dem Beratungsfehler Kenntnis genommen hat oder hätte nehmen müssen. „Letzteres lässt Spielraum für Fehlurteile“ erklärt Kälberer – so wie in einem Fall vor dem Frankfurter Oberlandesgericht.
Höchstrichterlich ist längst entschieden, dass Anlageberater im Beratungsgespräch alle entscheidungsrelevanten Informationen auf den Tisch legen müssen. Trotzdem entschied das OLG Frankfurt am Main im Januar, ein Anleger habe grob fahrlässig gehandelt, weil er die falschen Informationen seines Beraters nicht anhand der Angaben im Anlageprospekt überprüft habe (Aktenzeichen 18 U 28/07). Als Folge verschob das Gericht den Start der Verjährungsfrist auf das Ende des Jahres, in dem der Anleger den Fondsprospekt erhalten hatte. „Auf diese Schiene wird die Commerzbank in Zukunft bei den VIP-Fonds setzen“, vermutet Kälberer, „für mich ist das so sicher wie das Amen in der Kirche.“
Warum Anleger mit VIP-Fonds ihre Anlageberater in Regress nehmen können
Hätte die „Neue Frankfurter Logik“ Bestand, wären die Commerzbank und alle anderen Vermittler der VIP-Medienfonds aus dem Schneider. Das Nachsehen hätten alle Anleger, die bisher noch keine Schadensersatzklage erhoben haben. „In diesem Fall wären schon Ende 2007 Regressansprüche im Wert von rund 500 Millionen Euro verjährt gewesen“, sagt Kälberer.
Doch das OLG Frankfurt hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Kälberer: „Der Urteilsspruch hätte vor dem Bundesgerichtshof keine Chance.“ Was Wunder, dass das Frankfurter Gericht eine Revision erst gar nicht zugelassen hat. Der Bundesgerichtshof (BGH) hätte das fragwürdige Urteil vermutlich sofort kassiert. Die Karlsruher Richter haben längst zwei grundsätzliche Rechtsfragen entschieden:
- Erstens dürfen sich Kapitalanleger auf die Informationen ihrer Anlageberater verlassen.
- Zweitens brauchen Anleger die Aussagen ihrer Berater nicht mit den Prospektangaben zu vergleichen. „Wer den Anlageprospekt nicht liest, handelt folglich auch nicht grob fahrlässig“, erklärt Kälberer.
Zu einer solchen Überprüfung wären die meisten Anleger auch gar nicht in der Lage. Das LG Berlin ging im oben zitierten Urteil mit dem Anlageprospekt des VIP-Medienfonds hart ins Gericht: „Abgesehen davon, dass es für den unerfahrenen Anleger eine Zumutung darstellen dürfte, den gesamten verklausulierten Text des Prospektes vollständig zu lesen und zu verstehen, zeigt auch das Verhalten des Beklagten selbst, dass der Text so schwierig und unverständlich ist, dass er sich sogar einem – überdurchschnittlich geschulten – Anlageberater nicht erschließt.“ Diese Passage der Urteilsbegründung bestätigt, was Anlegeranwälte seit langem kritisieren: „Das Landgericht Berlin hat mit dieser Aussage den Finger in die Hauptwunde der Anlageprospekte gelegt“, sagt Kälberer, „als präventiver Anlegerschutz taugen die Prospekte so viel wie ein Jutesack als Regenschirm.“ Dem Frankfurter Urteil erteilte das LG Berlin insgesamt eine deutliche Abfuhr. Der Richter brauchte dafür nur wenige Worte: „Die Entscheidung überzeugt nicht.“
Gravierende Fehler in Fondsprospekt gerichtlich festgestellt
Das Berliner Urteil ist für Anleger auch aus einer zweiten Hinsicht erfreulich. „Das Urteil entschärft nicht nur die Verjährungsfalle der Commerzbank“, sagt Rechtsanwalt Kälberer, „das Urteil ist bundesweit auch das erste, das eindeutig bei VIP-Medienfonds gravierende Fehler im Anlageprospekt gerichtlich feststellt.“ Laut Urteil fehlt im Prospekt für den VIP-3-Medienfonds ein deutlicher Hinweis, dass der Fonds den Löwenanteil der Anlegereinlagen überhaupt nicht in Filme investieren konnte. Im Gegenteil: Allein 17,8 Prozent der Zeichnungssumme gingen für weiche Kosten drauf. Von den restlichen 87,2 Prozent wurden wiederum vier Fünftel postwendend an Banken für eine Schuldübernahmeerklärung überwiesen. Das haben die Anleger als Garantie ihrer Investition verstanden.
Ein fataler Irrtum. „Die Schuldübernahme hatte mit einer Garantie so viel zu tun wie ein Schleudersitz mit einem Sicherheitsgurt“, erklärt Rechtsanwalt Dietmar Kälberer. Denn das Steuersparmodell ist letztlich an der Schuldübernahme gescheitert. Als die Finanzbehörden nachrechneten, wie viel Geld der Anleger wirklich für die Filmproduktion zur Verfügung stand, kamen sie gerade einmal auf einen Anteil von mageren knapp 17 Prozent der Zeichnungssumme. Das reichte den Finanzbeamten, um die erhofften Steuervorteile nachträglich zu kassieren und von den Anlegern die bereits veranlagte Steuerersparnis in Millionenhöhe einzufordern.