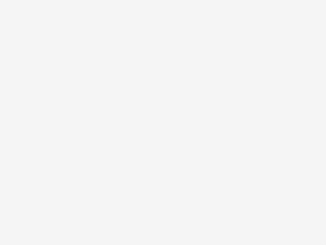Banken haben Unternehmen Swaps als Kapitalanlagen angedreht. Und die Unternehmen haben prompt viel Geld verloren. Doch dagegen können sich die Unternehmer vor Gericht mit Erfolg wehren und Schadensersatz verlangen. Das zeigt ein Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main gegen die Deutsche Bank.
Das Frankfurter Landgericht hat die Deutsche Bank in erster Instanz verurteilt, einem Kunden den mit einem CMS-Spread-Sammler-Swap erlittenen Schaden zu ersetzen (Aktenzeichen 2-04 O 388/06). Solche Finanztermingeschäfte sind im Grunde nichts anderes als Wetten auf bestimmte Zinssätze.
Die Deutsche Bank hat im Urteilsfall zwei entscheidende Fehler gemacht, die nach Erfahrung der Kanzlei Kälberer & Tittel Rechtsanwälte auch bei anderen Banken auftauchen:
1. Die Deutsche Bank hat gegen das Transparenzgebot verstoßen, das für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt. Der Vertrag ist deshalb unwirksam.
2. Die Deutsche Bank hat ihre Beratungspflichten verletzt und muss dem Kunden den Schaden ersetzen. Hier geht es um einen für Banken typischen Interessenskonflikt: Einerseits nimmt die Bank als Hausbank des Kunden hohes Vertrauen in Anspruch und verspricht dem Beratungskunden, diesen bestens in seinem Interesse zu beraten. Andererseits ist die Bank ein gewinnorientiertes Unternehmen. Je mehr die Bank an einem Produkt verdient, um so schlechter werden die Aussichten des Kunden auf eine Beratung in seinem Sinne. Je höher der Gewinn der Bank, desto größer ist die Gefahr, dass der Kunde falsch beraten wird.
Banken müssen über Interessenkonflikte aufklären
Genau das ist der Grund, warum das Wertpapierhandelsgesetz Banken verpflichtet, „sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen“. Ist das nicht ganz möglich, muss die Bank ihren Kunden wenigstens über den Interessenskonflikt aufklären und ihm alle „zweckdienlichen Informationen“ mitteilen.
Die schlichte Information, dass es einen Konflikt gebe, reicht nicht aus. Kunden haben bei Finanztermingeschäften und im Wertpapierhandel vielmehr das Recht zu erfahren, wie groß das Umsatzinteresse ihrer Bank genau ist. Nur so können sie „den Grad ihrer Gefährdung aufgrund dieses Interesses einschätzen“, so die Frankfurter Richter.
Geradezu spektakulär ist die Begründung. Denn die Frankfurter Richter haben im Urteilsfall erstmals die Kickback-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) für Aktienfonds auf Finanztermingeschäfte angewendet. Mit dieser Rechtsprechung hat der BGH Banken untersagt, beim Kauf von Aktienfonds für Kunden von den Investmentgesellschaften versteckte Provisionen zu kassieren. Denn diese Rückvergütungen verhindern, dass die Kunden das Eigeninteresse der Banken richtig einschätzen können.
Neben der Gewinnmarge muss die Bank auch Auskunft über den Marktwert des Finanztermingeschäftes geben. Warum das zu den „zweckdienlichen und somit zwingend mitzuteilenden Informationen“ zählt, hat das Frankfurter Gericht so begründet: Diese Information kann einen entscheidenden Beitrag dazu geben, dass ein Kunde feststellen kann, ob bei dem angebotenen Finanztermingeschäft „ein angemessenes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken“ besteht.
Im konkreten Fall räumte die Deutsche Bank erst im Laufe des Gerichtsverfahrens ein, dass der Gewinn der Bank „im kleinen einstelligen Prozentbereich“ liegen würde. Doch das war dem Frankfurter Landgericht nicht präzise genug. Über den Marktwert erfuhr der Kunde rein gar nichts. Indem die Banker beides verschwiegen, verstieß die Deutsche Bank gegen ihre Aufklärungspflichten und ist deshalb schadensersatzpflichtig. Anders ausgedrückt: Der Kunde bekommt die bisher gezahlten 240.000 Euro zurück und muss auch in Zukunft nicht jedes Halbjahr weitere 80.000 Euro (maximaler Verlust 800.000 euro) bezahlen. Dass er bei richtiger Aufklärung auch wirklich anders gehandelt hätte, musste er vor Gericht nicht beweisen. Davon gehen Richter regelmäßig aus, wenn Banken oder Anlageberater gegen ihre Aufklärungspflichten verstoßen.
Die Deutsche Bank wollte auch vor Gericht keine genauen Angaben zur Gewinnmarge machen. Das sahen die Richter als Indiz für eine „so hohe Marge, … dass die Klägerin von dem Swap-Geschäft abgesehen hätte“.
Transparenzgebot gilt auch bei Finanztermingeschäften
Das Urteil macht mit Bezug auf EU-Richtlinien und die BGH-Rechtsprechung den hohen Anspruch an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Finanztermingeschäften klar. Demnach sind zumindest die Hauptleistungspflichten so darzustellen, „dass ihre Bedeutung und Tragweite“ vom Kunden „leicht erfasst werden“ können. Es reicht also nicht aus, wenn die Bank die mögliche Kostenbelastung des Kunden in einer „gerade noch verständlichen Weise“ darstellt. Das Transparenzgebot gebiete vielmehr, dass die Bank ihre AGB so deutlich formuliert, dass der Kunde die Kosten- und Verlustrisiken „unschwer mit möglichst wenigen Zwischenschritten“ und „mit hinreichender Präzision“ erfassen kann.
Anders formuliert: „Die Bank muss dem Kunden bei den Gewinnchancen und Verlustrisiken reinen Wein einschenken“, erklärt Rechtsanwalt Kälberer. Genau das hat die Deutsche Bank im Urteilsfall aber nicht getan. Statt die gegenseitigen Zahlungspflichten deutlich zu beziffern, servierte die Deutsche Bank ihren Kunden Formeln mit völlig überflüssigen Rechenschritten.
Diese trickreiche Aufblähung von Formeln kann eine unangemessene Benachteiligung von Kunden sein. Denn je länger eine Formel, desto größer ist laut Urteil die Gefahr, „dass der Kunde die Berechnung der Hauptleistungspflichten erst gar nicht versucht zu verstehen oder dabei einem Irrtum erliegt“. Das trifft selbst dann zu, wenn die unnötigen Rechenschritte in der Formel im Grunde leicht zu überwinden sind, etwa wenn die Bank wie im Urteilsfall die Belastung von 10 Prozent auf scheinbar 5 Prozent halbiert und zum Ausgleich in die Formel an einer anderen Stelle den Faktor 2 einbaut.
Um eine unangemessene Benachteiligung aufgrund mangelnder Transparenz zu beklagen, ist es nicht nötig, dass der Kunde die Rechenschritte der Formel überhaupt nicht verstehen könne. Es reicht schon die Gefahr, dass sich der Kunde wegen der zusätzlichen Rechenschritte irren und das Ausmaß seiner Belastungen deshalb nicht richtig erfassen könnte.
Die mangelnde Transparenz führt dazu, dass der Vertrag komplett unwirksam ist. Eine ergänzende Vertragsauslegung sei im konkreten Fall nicht möglich, so die Richter, die angesichts der vermuteten Interessen von Bank und Kunde nicht einmal im Sinne eines hypothetischen Parteiwillens eine Übereinstimmung erkennen konnten.